Rechtsratgeber
Wer kommt für den Schaden am Arbeitsplatz auf?
16. Mai 2025 agvs-upsa.ch – Nach Werkstattarbeiten ist eine Probefahrt üblich. Doch was passiert, wenn Mitarbeitende während solcher Fahrten einen Schaden verursachen? Wer haftet in diesem Fall – Verursachende oder Arbeitgebende? Sarina Zürcher und Tahir Pardhan

Für absichtliche oder fahrlässig herbeigeführte Schäden an Kunden-Fahrzeugen können die Mitarbeitenden zur Verantwortung gezogen werden. Foto: iStock


Mitarbeitende können für Schäden verantwortlich gemacht werden, welche Arbeitgebenden vorsätzlich oder fahrlässig zugefügt werden (Art. 321 e Abs. 1 OR). Allerdings haben Arbeitnehmende nur für die in Art. 321 e Abs. 2 OR vorgesehene Sorgfalt einzustehen.
Damit Arbeitnehmende haftbar gemacht werden können, müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein:
Sind alle vier Voraussetzungen erfüllt, können Verursachende für den Schaden verantwortlich gemacht werden. Um festzustellen, wie viel Schadensersatz im Einzelfall geschuldet sein kann, werden in der Rechtsprechung folgende Ansätze verfolgt:
Sind die Voraussetzungen für eine Haftung seitens Arbeitnehmende gegeben, können Arbeitgebende ihre Schadenersatzforderung unter den Voraussetzungen von Art. 120 OR mit dem geschuldeten Lohn verrechnen. Dies muss allerdings möglichst rasch nach Bekanntwerden der Haftung erfolgen (mit der nächsten Lohnzahlung) und Arbeitnehmende sind schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen. Ein langes Zuwarten kann als Verzicht auf den Schadenersatz interpretiert werden, womit die Haftung verfallen kann. Grundsätzlich darf bei der Verrechnung nur so viel vom Lohn abgezogen werden, dass das Existenzminimum nicht unterschritten wird. Das Existenzminimum besteht aus dem Lohnanteil, welcher für Arbeitnehmende und deren Familie lebensnotwendig sind. Für die entsprechenden Ansätze ist jeweils das Betreibungsamt am Wohnort der betroffenen Person zu konsultieren. Zudem muss der Lohn gemäss Art. 93 SchKG noch pfändbar sein. Von der Beachtung des Existenzminimums darf aber abgewichen werden, wenn der Schaden vorsätzlich verursacht wurde (Art. 323b OR).
Damit Sie im Schadenfall nicht auf den Kosten sitzenbleiben, ist es entscheidend, möglichst rasch korrekt zu handeln. Dieser Artikel bietet Ihnen die nötige Sicherheit, um Ihre Rechte durchzusetzen.

Für absichtliche oder fahrlässig herbeigeführte Schäden an Kunden-Fahrzeugen können die Mitarbeitenden zur Verantwortung gezogen werden. Foto: iStock

Sarina Zürcher, juristische Mitarbeiterin Rechtsdienst.

Tahir Pardhan, Leiter Recht & Politik.
Mitarbeitende können für Schäden verantwortlich gemacht werden, welche Arbeitgebenden vorsätzlich oder fahrlässig zugefügt werden (Art. 321 e Abs. 1 OR). Allerdings haben Arbeitnehmende nur für die in Art. 321 e Abs. 2 OR vorgesehene Sorgfalt einzustehen.
Damit Arbeitnehmende haftbar gemacht werden können, müssen vier Voraussetzungen erfüllt sein:
- Es muss ein Schaden entstanden sein. Oft handelt es sich dabei um Sachbeschädigungen wie beispielsweise die Beschädigung von Fahrzeugen, Maschinen oder von Gebäuden.
- Weiter braucht es eine Vertragsverletzung, das heisst der Arbeitnehmende muss gegen eine arbeitsvertragliche Pflicht verstossen. Die Verletzung der gebotenen Sorgfalt im Schadenfall stellt bereits eine arbeitsrechtliche Pflichtverletzung dar.
- Zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden braucht es einen unmittelbaren Zusammenhang. Der Schaden muss also durch die Handlung oder eine Untätigkeit der Arbeitnehmenden kausal verursacht worden sein.
- Zum Schluss muss nachgewiesen werden, dass die verursachende Person eine Schuld trifft. Der Schaden muss vorsätzlich oder fahrlässig verursacht sein. Dabei wird bei der Fahrlässigkeit zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit unterschieden. Leichte Fahrlässigkeit wird angenommen, wenn die Person ihre Sorgfaltspflicht in geringem Mass verletzt, etwa durch eine kleine Unachtsamkeit. Grobfahrlässig handeln Arbeitnehmende durch eine schwerwiegende Sorgfaltspflichtverletzung, welche durch erhöhte Aufmerksamkeit hätte verhindert werden können.
- Bei leichter Fahrlässigkeit gilt als Faustregel, dass die Weiterbelastung des Schadens auf die verursachende Person etwa im Umfang eines Monatsgehalts zulässig ist. Kann aber nachgewiesen werden, dass es sich beim Schadenhergang um einen Fall handelt, bei welchem üblicherweise schnell ein Schaden entstehen kann, ist eine Arbeitnehmerhaftung sogar eher ausgeschlossen.
- Ist der Schaden grob fahrlässig herbeigeführt worden, können bis zu drei Monatslöhne als Schadensersatz weiterbelastet werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Arbeitnehmende wichtige Vorsichtspflichten missachtet hat, welche ein vernünftig handelnder Mensch beachtet hätte.
- Wurde vorsätzlich gehandelt, kann grundsätzlich der gesamte Schaden eingefordert werden.
Sind die Voraussetzungen für eine Haftung seitens Arbeitnehmende gegeben, können Arbeitgebende ihre Schadenersatzforderung unter den Voraussetzungen von Art. 120 OR mit dem geschuldeten Lohn verrechnen. Dies muss allerdings möglichst rasch nach Bekanntwerden der Haftung erfolgen (mit der nächsten Lohnzahlung) und Arbeitnehmende sind schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen. Ein langes Zuwarten kann als Verzicht auf den Schadenersatz interpretiert werden, womit die Haftung verfallen kann. Grundsätzlich darf bei der Verrechnung nur so viel vom Lohn abgezogen werden, dass das Existenzminimum nicht unterschritten wird. Das Existenzminimum besteht aus dem Lohnanteil, welcher für Arbeitnehmende und deren Familie lebensnotwendig sind. Für die entsprechenden Ansätze ist jeweils das Betreibungsamt am Wohnort der betroffenen Person zu konsultieren. Zudem muss der Lohn gemäss Art. 93 SchKG noch pfändbar sein. Von der Beachtung des Existenzminimums darf aber abgewichen werden, wenn der Schaden vorsätzlich verursacht wurde (Art. 323b OR).
Damit Sie im Schadenfall nicht auf den Kosten sitzenbleiben, ist es entscheidend, möglichst rasch korrekt zu handeln. Dieser Artikel bietet Ihnen die nötige Sicherheit, um Ihre Rechte durchzusetzen.
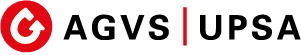

Kommentar hinzufügen
Kommentare